Inhaltsverzeichnis auf einen Blick
Ein Erfahrungsbericht von der Yes!Con 2025 mit Einblicken in die Zukunft der gemeinsamen Entscheidungsfindung
Plötzlich sind wir mindestens zu viert im Sprechzimmer.
Der Raum ist klein, die Stühle knapp – aber das Thema groß und hochaktuell. Auf der diesjährigen Yes!Con, einer Veranstaltung für Krebsbetroffene und -interessierte in Berlin, war der Workshop von der Psychologin und Psychoonkologin Dr. Martina Preisler nüchtern betitelt: „KI als Helferin: Richtig fragen, Vorteile nutzen, Grenzen kennen“.
Meine Gedanken dazu sind eher komplex, meine Haltung zwischen Neugierde und kritischem Stirnrunzeln. Etwas verändert sich, nicht irgendwann, sondern jetzt. Und zwar in der Gesellschaft und damit auch in einem Kontext, der für Patienten eine große Rolle spielt: im Arztgespräch.
„Ich hätte dir auch nicht viel anderes gesagt, Martina“
Martina Preisler ist Psychoonkologin und zwar eine, die nicht nur theoretisch über KI spricht. Sie hat ihre Blutwerte analysieren lassen; einmal von befreundeten Onkologen, einmal von einer KI (mit geschwärzten Passagen natürlich). Die Ergebnisse waren nahezu deckungsgleich. Ihre Freundin und Onkologin meinte selbst sehr überrascht über das Ergebnis: „Ich hätte dir auch nicht viel anderes gesagt, Martina.“
Auch bei Therapieempfehlungen zeigte sich: Die KI konnte erstaunlich zuverlässig arbeiten. Aber nur unter der Bedingung, dass man sie richtig füttert. Prompt-Kenntnisse, das Wissen um Datenschutz (keine Namen, keine PDFs mit Metadaten), das Verstehen und Bewerten von Halluzinationen der KI – all das wird plötzlich zur Gesundheitskompetenz.
Shared Decision Making (SDM): Der neue Dialog
Was mir in dem Workshop klar wurde, ist die immense Wichtigkeit des kompetenten Dialogs. Das bestätigt auch das aktuelle Whitepaper „KI und Shared Decision Making – White Paper zur gemeinsamen Entscheidungsfindung“ der Initiative „Patient:in im Fokus“. Dort heißt es: Künstliche Intelligenz kann helfen, die sogenannte stille Fehldiagnose zu vermeiden, also die Lücke zwischen ärztlicher Annahme und patientischer Realität. SDM lebt von Dialog, Fragen und dem Abgleich individueller Ziele. Genau da kann KI wirken: als Übersetzer, Strukturgeber, Gedankenanreger.
Ein gut gestellter Prompt auf behandelnder Seite vor dem Gespräch kann Fragen ermitteln, die dann den Wunsch der Patienten erfassen, um daraus wiederum die beste Behandlungsoption zu entwickeln. So kann KI nicht nur medizinische, sondern auch menschliche Faktoren sichtbar machen. Das Problem, so Dr. Sven Jungmann (Arzt und Unternehmer), seien „stille Fehldiagnosen“, die auf falschen Annahmen der Behandelnden beruhen.
Aufgeführt wird dazu unter anderem das Ergebnis einer Studie aus Großbritannien, in der nur 7 Prozent der Brustkrebspatientinnen den Erhalt ihrer Brust anstreben, während 71 Prozent der Ärzte das Gegenteil erwartet hatten. Das führt dann dazu, dass die Wünsche der Patientinnen nicht gesehen werden und in der Folge auch keine Alternativen angeboten oder Behandlungen von Anfang an anders angelegt werden.
Zwischen Kittel und Cloud: Die neuen Mitspieler
Im Talk „Zwischen Kittel und Cloud – ein Deep-Tech-Talk“ mit Dr. Jens Baas (Vorsitzender des Vorstandes der Techniker Krankenkasse) und Autor Sascha Lobo, fiel ein Satz, der mich nicht loslässt: „Wir sind nicht mehr zu zweit im Sprechzimmer. Bald sind wir mindestens zu viert.“
Was gemeint ist: Neben Arzt und Patient mischen sich jetzt zwei weitere Stimmen ein – nämlich die jeweiligen KI-Agenten der beiden Hauptakteure. Sie arbeiten im Hintergrund, analysieren, bewerten, geben Empfehlungen. Und sie nehmen verschiedene Rollen ein: Kollegin, Therapeutin, Vater, Freund. Es wird also bald sehr voll im Sprechzimmer.
Auf einer anderen Veranstaltung traf ich einen KI-Experten, der mir davon berichtete, dass bereits an KI-Tools gearbeitet wird, die das Arztgespräch aufzeichnen – selbstverständlich nach Zustimmung des Patienten – und es nachher zu einem Arztbrief zusammenfassen. Die behandelnde Person hat dann nur noch die Aufgabe, das Erfasste gegenzulesen und mit ihren fachlichen Anmerkungen zu versehen.
Was kann KI derzeit?• Arztbriefe in einfache Sprache übersetzen |
Was auffällt: All das sind Tätigkeiten, die zwar Zeit sparen, aber auch Verantwortung verlagern. Wer als Patient mit gut formulierten Prompts zum Arzt kommt, ist besser vorbereitet. Doch was ist mit denen, die das nicht können?
Die neue Kluft: KI-Versteher versus KI-Nichtversteher
Eine weitere Erkenntnis: Künstliche Intelligenz schafft Lösungen, aber auch neue Hürden. Es entsteht eine Lücke zwischen denen, die souverän mit ihr umgehen, und denen, die sie eher verwirrt. Das Resultat: ein Spannungsfeld zwischen digitaler Teilhabe und digitaler Überforderung. Die einen prompten mit medizinischem Know-how – die anderen googlen noch.
Hier entsteht eine neue Form von Ungleichheit, die nicht nur soziale, sondern auch therapeutische Konsequenzen haben kann. Wer die richtigen Fragen stellt, bekommt die besseren Antworten. Aber wer bringt uns das bei? Auch dafür gibt es bereits vorgefertigte Prompts, die allerdings nicht per Copy and Paste übernommen werden sollten, erklärte Preisler.
Anderenfalls würden versteckte Codes mitkopiert, die Tracking-Parameter enthalten. Das bedeutet für sensible Kontexte wie bei Gesundheitsdaten, dass sie vom Prompt-Anbieter mitgeschnitten werden können oder zumindest wiedererkannt werden. Tipp: einfach den Text selbst eintippen.
Was ich als Patientin auch kritisch sehe, ist die Tatsache, dass es trotz allem gefährliches Halbwissen gibt. Wir Patienten verfügen natürlich nicht über das Kontextwissen eines Arztes. Für mich ist das das „Ich-weiß-Bescheid-Syndrom“ – und das führt wiederum auf Patientenseite zu falschen Annahmen, welche die Behandlung verkomplizieren können. Nach dem Motto: „Ich denke, ich weiß, was mir fehlt. Sagen Sie mir jetzt nur, wie Sie das behandeln.“ Am Austausch der Überlegungen führt meines Erachtens auch der KI-Weg nicht vorbei.
Arztgespräch Deluxe: Mehr Zeit für das Wesentliche?
Was mir Hoffnung macht, ist, dass die KI Routinen abnehmen, sortieren, dokumentieren kann. So entlastet sie Ärzte und führt dazu, die Behandlung neu zu fokussieren. Das Arztgespräch als Raum, in dem Vertrauen entsteht, Unsicherheiten geteilt und Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Eventuell ist das die größte Chance: Das Gespräch wird wieder menschlicher, zugewandter, weil mehr Zeit dafür bleibt. Okay, vermutlich ist in Bezug auf die zur Verfügung stehende Zeit eher der Wunsch der Vater des Gedankens.
Ein weiterer Vorteil, der sich insbesondere in der psychologischen Begleitung zeigt und auf den die Psychologin Martina hinweist: „Es ist besser, kurz mit einem Chatbot zu sprechen, als gar keine Begleitung zu haben“. Mit dieser Aussage überraschte sie zunächst nicht nur mich in der Workshoprunde. Aber wenn ich mir überlege, dass Patienten manchmal fast sechs Monate – teilweise sogar länger – auf einen Therapieplatz warten, ergibt das durchaus Sinn.
Übrigens: Gerade Männer nutzen diese Option. Warum? Na, weil sie nicht so offen mit ihrem Therapiebedürfnis umgehen wie Frauen. Das bestätigte auch Lobo. Wenn es optimal läuft, ist der Talk mit dem Chatbot dann vielleicht sogar die Brücke zur echten Therapie unter vier Augen und Ohren.
Die neue Rolle der Ärzte
Das klassische Arztbild verändert sich. Das ist nicht neu. Aus dem allwissenden Diagnostiker wird ein Partner für Patienten – sofern SDM gelebt wird – und künftig auch zunehmend ein Moderator. Ärzte stehen jetzt schon zwischen evidenzbasierter Medizin, KI-generierten Vorschlägen und individuellen Patientenwünschen. Sie müssen nicht nur medizinisch entscheiden, sondern auch KI-Ergebnisse einordnen, bewerten und erklären. Es braucht also eine neue Gesprächskultur und sicher auch neue Ausbildungskonzepte, die uns befähigen, mit all diesen Aspekten umzugehen.
Gesellschaftlicher Wandel inklusive
Auch gesellschaftlich verändert sich durch KI einiges: Es entsteht eine neue Form der Gesundheitskompetenz. Diese ist digital, prompt-basiert und kritisch reflektierend. Wer hier nicht mitkommt, könnte abgehängt werden.
Deshalb braucht es neben der Aufklärung auch Angebote, die sowohl Patienten als auch die in der Medizinbranche tätigen Fachleute mit dem Umgang von Prompts und dem Lesen der Ergebnisse schulen. Das Treffen von Therapieentscheidungen wird mit der aktiver werdenden Patientenseite erklärungsbedürftiger. Allein schon deshalb, weil die Grundlagen der Entscheidungen transparenter werden.
Wer jetzt noch denkt, ich mach da schnell mal einen Termin, sollte es besser wissen. Arztgespräche werden immer komplexer und anspruchsvoller – für beide Seiten. Oder sollte es heißen „für alle Seiten“? Hoffentlich kommen wir da alle noch hinterher. Ach ja, bevor ich es vergesse: Auch das Termine machen kann zukünftig der persönliche KI-Agent übernehmen – aber hier Augen auf in Sachen Datenschutz.
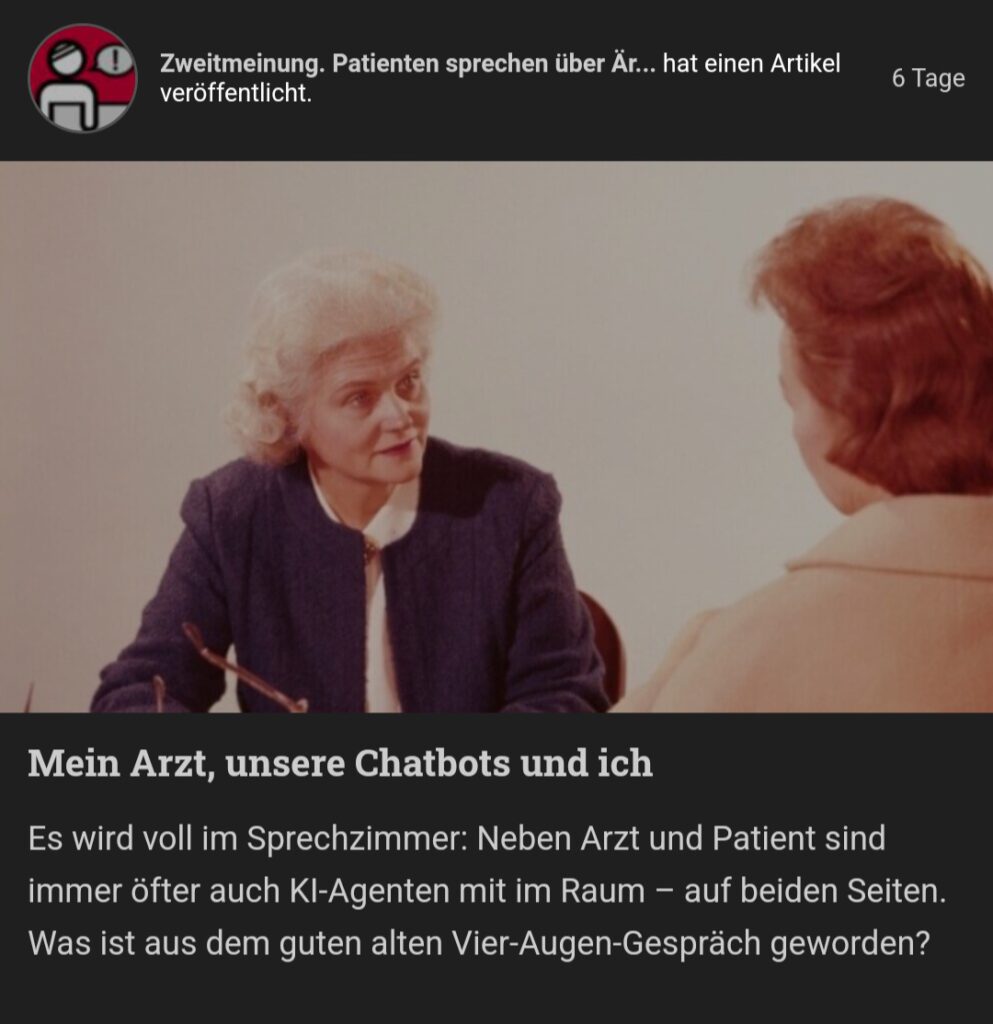
Dieser Artikel wurde zuvor auf dem Medizinportal DocCheck veröffentlicht. Unter dem Text findest viele interessante Kommentare, die zeigen, wie groß das Spektrum der Meinungen in der Medizinbranche ist. Ich finde das sehr interessant.
Daher hier der Link für dich: https://www.doccheck.com/de/detail/articles/51484-mein-arzt-unsere-chatbots-und-ich
Mein 1. Ratgeber: „Warum sagt mir das denn niemand?“ – Was Du nach einer Krebsdiagnose alles wissen musst!
Und ganz neu:
FLIEGEN MIT VERKLEBTEN FEDERN. Wie Du nach der Krebstherapie Dein Leben neu entfaltest. Ein Erfahrungs- und Strategiebuch.
Veröffentlich am 4. Februar 2026.
Für mehr Informationen, klicke auf diesen Link.


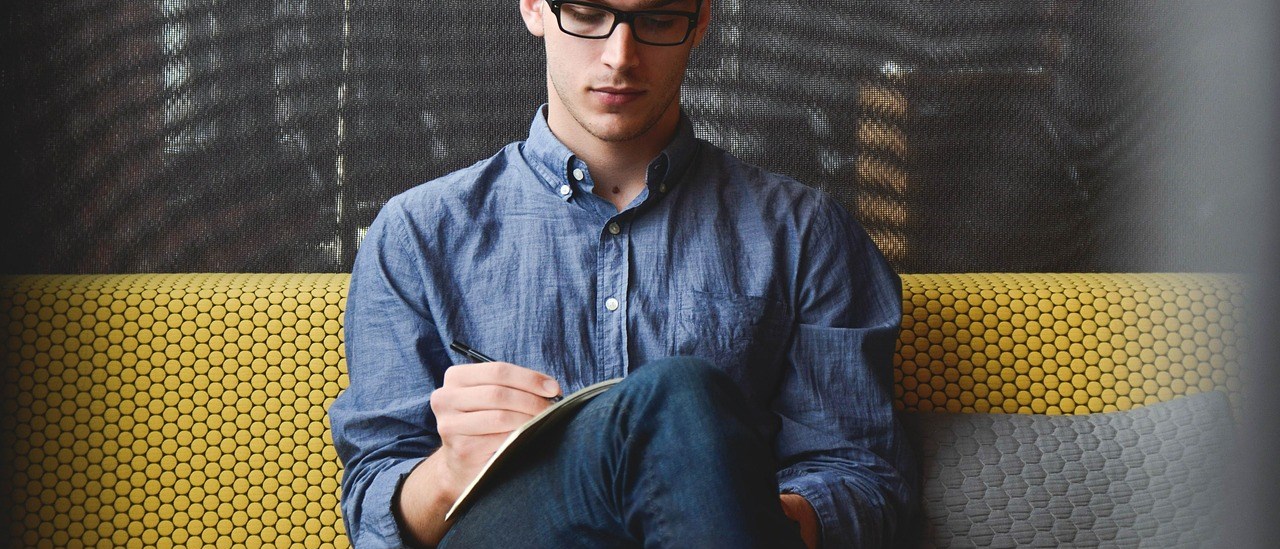

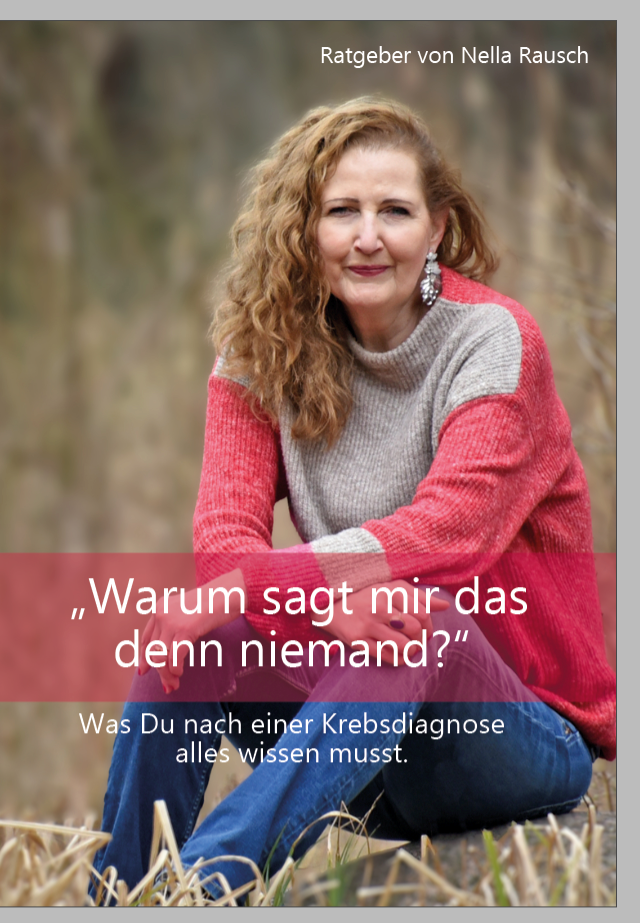
2 Gedanken zu „Achtung, KI-Agenten im Arztgespräch.“
SDM hört sich prima an! Wird an Kliniken vielfach propagiert, aber in vielerlei Hinsicht von der Ärzteschaft nicht gelebt – weil nicht gewünscht, weil zeitaufwendig, weil ein informierter Patient unbequem ist ?!?
Meine bisherigen Erfahrungen sind andere, liebe/r Namenlose/r.